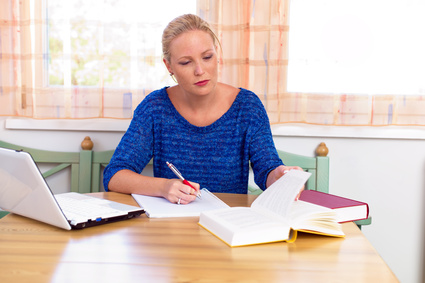Gründen im Hörsaal? Warum Studierende trotz hoher Motivation selten Startups wagen
Die deutsche Gründerlandschaft ist vielfältig, innovationsfreudig und zunehmend digitalisiert. Doch eine Gruppe, die in diesem Kontext besonders vielversprechend erscheint, bleibt weitgehend unterrepräsentiert: Studierende.
Zahlreiche Umfragen und Studien belegen eine hohe Bereitschaft zur Firmengründung innerhalb dieser Altersgruppe. Trotzdem ist die Zahl der tatsächlich von Studierenden initiierten Startups überschaubar. Woran liegt das? Und wie könnte das Bildungssystem dazu beitragen, den Gründungsgeist besser zu fördern?
Gründungsbereitschaft trifft auf Realitätsschock
Laut einer Untersuchung der RND unter Berufung auf eine Studie der Universität Mannheim zeigen rund 40 Prozent aller Studierenden grundsätzlich Interesse daran, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Doch nur ein Bruchteil dieser potenziellen Gründer:innen setzt die Idee in die Tat um. So entstehen lediglich etwa 11 Prozent aller deutschen Startups im unmittelbaren Kontext eines Studiums. Dabei ist gerade diese Lebensphase prädestiniert für kreative und zukunftsweisende Ideen: Junge Menschen sind oft risikobereiter, haben frischen Zugang zu Technologien und bringen neuartige Denkweisen mit.
Doch der Weg von der Idee zur tatsächlichen Gründung ist komplexer als gedacht. Es fehlt nicht an Motivation, sondern an Strukturen, Unterstützung und einer systematischen Heranführung an das Unternehmertum. Viele Studierende fühlen sich schlichtweg überfordert. Begriffe wie Businessplan, Buchhaltung, Steuerrecht oder Kapitalbeschaffung klingen für viele eher abschreckend als anziehend. Hinzu kommen Unsicherheiten bezüglich der eigenen Fähigkeiten, fehlende Netzwerke und der Druck, parallel das Studium erfolgreich zu absolvieren.
Defizite im Bildungssystem: Unternehmerisches Denken bleibt Randerscheinung
Ein zentrales Hindernis für studentische Gründungen ist die mangelnde Verankerung von Entrepreneurship im deutschen Bildungssystem. Bereits in der Schule fehlt es an gezielter Aufklärung über wirtschaftliche Zusammenhänge und unternehmerische Möglichkeiten. Laut Bitkom gaben 95 Prozent der befragten Startup-Gründer:innen an, in ihrer Schulzeit keine oder kaum Informationen zur Selbstständigkeit erhalten zu haben. Dieses Defizit setzt sich in den Hochschulen fort: Nur wenige Studiengänge bieten Module, die sich konkret mit Unternehmensgründung, Innovationsmanagement oder Startup-Finanzierung beschäftigen.
Stattdessen dominieren klassische akademische Karrierepfade. Viele Professor:innen sind selbst nie unternehmerisch tätig gewesen, weshalb es an Vorbildern und gelebter Gründungskultur fehlt. Hinzu kommt, dass sich viele Hochschulen schwer damit tun, interdisziplinäres Arbeiten zu fördern. Dabei entstehen innovative Gründungsideen oft gerade dann, wenn etwa Informatiker:innen mit Designer:innen und Betriebswirt:innen gemeinsam an einem Projekt arbeiten.
Was Studierende wirklich brauchen: Raum, Ressourcen und Rollenvorbilder
Um Gründungsinteresse in echtes Unternehmertum zu überführen, braucht es mehr als bloße Appelle. Es braucht konkrete Unterstützung in Form von Beratungsangeboten, Finanzierungshilfen, Networking-Möglichkeiten und praxisorientierter Ausbildung. Erfolgreiche Beispiele wie das „LMU Entrepreneurship Center“ in München oder „UnternehmerTUM“ in Garching zeigen, wie Universitäten ein inspirierendes Ökosystem für Startups schaffen können.
Diese Einrichtungen bieten Studierenden nicht nur Zugang zu Mentoren und Investoren, sondern auch physische Räume zum Arbeiten, technische Infrastruktur und Schulungen zu Themen wie Pitch-Training, Business Development oder rechtliche Grundlagen. Solche Strukturen helfen, die Angst vor dem „großen Unbekannten“ zu reduzieren und machen das Abenteuer Gründung greifbar.
Ebenso wichtig ist die Förderung weiblicher Gründerinnen. Studien zeigen, dass Frauen deutlich seltener gründen als Männer, obwohl sie ähnlich qualifiziert sind. Das liegt auch daran, dass es an weiblichen Rollenvorbildern mangelt. Hochschulen könnten gezielt erfolgreiche Unternehmerinnen einladen, um Studierende zu inspirieren und stereotype Bilder aufzubrechen.
Förderprogramme und Startkapital: Eine Frage des Zugangs
Neben Mentoring und Netzwerken ist insbesondere die Finanzierung ein entscheidender Faktor. Viele Studierende scheuen das finanzielle Risiko einer Gründung. Zwar existieren Programme wie das EXIST-Gründerstipendium, das akademische Gründungsvorhaben unterstützt, doch ist der Zugang oft komplex und wenig transparent.
Die Antragstellung erfordert Zeit, die Studierende neben ihrem Studium kaum aufbringen können. Zudem fehlt es häufig an Beratung bei der Auswahl geeigneter Förderinstrumente. Hochschulen sollten hier eine vermittelnde Rolle einnehmen und gezielte Workshops zur Antragsstellung sowie Übersichten über mögliche Finanzierungswege anbieten.
Darüber hinaus wäre es sinnvoll, Mikrokredite oder spezielle Gründungsfonds für Studierende einzurichten. Diese könnten niedrigschwellig vergeben werden und würden den ersten Schritt in die Selbstständigkeit erleichtern.
Empfehlungen für ein gründerfreundlicheres Bildungssystem
Wenn Deutschland das kreative Potenzial seiner Studierenden besser nutzen will, bedarf es tiefgreifender Veränderungen im Bildungssystem. Dazu gehören:
- Frühzeitige Entrepreneurship-Education: Bereits in der Oberstufe sollten wirtschaftliche Zusammenhänge, Gründungsprozesse und unternehmerisches Denken Teil des Unterrichts sein.
- Verankerung in Curricula: Hochschulen sollten verpflichtende oder wahlweise Gründungsmodule in allen Fachrichtungen anbieten.
- Praxisnahe Lehrformate: Planspiele, Startup-Projekte, Summer Schools und Gründungswettbewerbe können Studierende aktiv einbinden.
- Stärkung von Netzwerken: Hochschulen sollten gezielt Kooperationen mit Startups, Unternehmen und Gründerzentren aufbauen.
- Diversität fördern: Weibliche und internationale Studierende sollten gezielt angesprochen und unterstützt werden.
Potenzial ist vorhanden – jetzt ist das System gefragt
Deutschland hat kein Nachwuchsproblem, sondern ein Strukturproblem. Studierende bringen Kreativität, Motivation und Ideenreichtum mit. Was fehlt, ist ein Bildungssystem, das Unternehmertum nicht als Ausnahme, sondern als gleichwertige Karriereoption begreift.
Mit gezielter Förderung, besseren Rahmenbedingungen und mehr praktischer Erfahrung könnte sich die Hochschullandschaft in eine wahre Innovationsschmiede verwandeln. Dann wären Gründungen aus dem Hörsaal nicht mehr die Ausnahme, sondern ein selbstverständlicher Bestandteil universitärer Ausbildung.